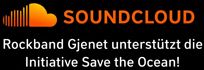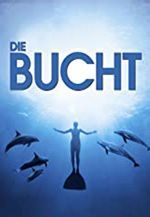Delfin und Waljagd auf den Färöer Inseln

Waljagd auf den Färöer Inseln
Jedes Jahr fallen auf den Färöer Inseln im Nordatlantik mehrere hundert Tiere der Jagd zum Opfer - vor allem Grindwale, Atlantische Weißseitendelfine, Entenwale und Große Tümmler. Bei der als „Grindadráp" bezeichneten Jagd werden ganze Familienverbände von Walen mit Motorbooten in Buchten getrieben. Dort erwarten sie schon eine Vielzahl von jungen Männern, die den Tieren stumpfe Metallhaken in die Blaslöcher treiben und sie auf den Strand ziehen. Mit scharfen Messern werden die Wirbelsäule und die Hauptarterien durchtrennt, so dass die Tiere verbluten.
Grausame Jagdmethoden
Aus Tierschutzsicht ist diese Jagdmethode als besonders grausam anzusehen, da die Delfine und Wale von Beginn des Treibens bis zur Tötung auf dem Strand enormem Stress ausgesetzt sind und keinesfalls tierschutzgerecht getötet werden. Zudem unterliegen die Treibjagden keinen internationalen Kontrollen, denn Dänemark erkennt keine Zuständigkeit internationaler oder regionaler Abkommen gegenüber den Kleinwaljagden an und auch die Internationale Walfangkommission fühlt sich für derartige Jagden nicht verantwortlich.
Die Jagd auf Delfine und Kleinwale hat auf den Färöer Inseln eine besonders lange Tradition, die bis innigreichs Dänemark, gelten aber als autonome Nation und gehören nicht zur EU. Diente die Jagd frühs 16. Jahrhundert zurück reicht. Zwar sind die im Nordatlantik gelegenen Färöer ein Teil des Köer noch zur Selbstversorgung der Inselbewohner, werden heute eher kulturelle Gründe angeführt, auch wenn das Fleisch weiterhin verzehrt wird.
Tierschutzorganisationen weisen bereits seit Jahren auf die starke Schadstoffbelastung des Walfleischs, unter anderem mit Quecksilber, hin. Selbst die Färinger Gesundheitsbehörde appellierte schon an die Bevölkerung, auf den Konsum des stark schadstoffbelasteten Grindwalfleisches zu verzichten.
Forderungen
Wir fordern ebenso wie andere europäische Tierschutzorganisationen ein Ende der brutalen Delfintreibjagden. Die Tötung und das Leid Tausender Tiere sind aus unserer Sicht nicht akzeptabel und zur Selbstversorgung der Färinger auch nicht mehr notwendig.
Grindwaljagd auf den Färöern: Neue Erkenntnisse und Kontroversen Tradition und Methode der Grindwaljagd
Die Grindwaljagd, auch bekannt als "Grindadráp," ist eine jahrhundertealte Tradition auf den Färöer Inseln. Dabei werden Grindwale, eine Delfinart, in die flachen Gewässer der Küste getrieben, wo sie gefangen und getötet werden. Die gängige Methode besteht darin, das Rückenmark der Wale mit Lanzen zu durchtrennen, um sie zu töten und ausbluten zu lassen.
Kritische Studie zur Tötungsmethode
Eine aktuelle Studie von Alick Simmons, ehemaliger stellvertretender Chefveterinär der britischen Regierung, in Auftrag gegeben von der Schweizer Organisation Ocean Care, stellt die Effektivität und Humanität dieser Tötungsmethode infrage. Simmons' Untersuchung zeigt, dass die Durchtrennung des Rückenmarks oft nicht zum schnellen Tod führt. Trotz der Lähmung der Tiere bleiben viele Wale noch bei Bewusstsein, da weiterhin Blut in das Gehirn fließen kann. Diese Methode unterscheidet sich von den üblichen Tötungspraktiken für andere zum Verzehr bestimmte Tiere, die in der Regel eine sofortige Bewusstlosigkeit und schnellen Tod anstreben.
Argumente der Befürworter
Befürworter der Grindwaljagd betonen deren kulturelle Bedeutung und die Notwendigkeit für die lokale Ernährung. Die Jagd wird als ökologisch nachhaltiger im Vergleich zur industriellen Fischerei dargestellt, da das Fleisch überwiegend lokal konsumiert wird und nicht in umweltschädlichen Containern transportiert werden muss.
Tierschutzperspektive
Ocean Care und andere Tierschutzorganisationen kritisieren die Grindwaljagd seit Jahren als grausam und unnötig. Die Studie von Simmons bestätigt deren Ansicht, dass die Jagd "inhärent unmenschlich" ist. Nicolas Entrup, Leiter der internationalen Zusammenarbeit bei Ocean Care, betont, dass der Prozess der Hetzjagd und die anschließende Tötung mit erheblichem Leid für die Tiere verbunden sind. Er plädiert dafür, die Beziehung der Gesellschaften zu Tieren und die eigenen Tötungspraktiken zu überdenken, da moderne wissenschaftliche Erkenntnisse über Meeressäuger deren Schutz und humane Behandlung erfordern.

Zukünftige Aussichten
Die Diskussion über die Grindwaljagd ist auch auf den Färöer Inseln in vollem Gange. Es besteht die Hoffnung, dass die Jagd in absehbarer Zukunft eingestellt wird, basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem wachsenden Bewusstsein für Tierschutz.
Die neue Studie von Alick Simmons liefert wichtige Einblicke in die umstrittene Praxis der Grindwaljagd auf den Färöer Inseln. Während Befürworter auf Tradition und ökologische Vorteile hinweisen, unterstreichen Tierschutzorganisationen das Leid der Tiere und fordern eine Neubewertung und letztlich das Ende dieser Praxis.

Prominente gemeinsam mit Save the Ocean gegen Tötungen von Meeressäugern auf den Färöer Inseln
Jedes Jahr fallen auf den Färöer Inseln im Nordatlantik fast tausend Tiere der Jagd zum Opfer - vor allem Grindwale, Delfine, Entenwale und große Tümmler. Bei der als „Grindadráp" bezeichneten Jagd treiben die Bewohner der Färöer Inseln ganze Familienverbände von Walen mit Motorbooten an die Küste und in Buchten und schlachten die Meeressäuger im flachen Wasser ab. Auch trächtige Tiere werden getötet.
Am Strand erwarten die Meeressäuger schon eine Vielzahl von Männern, die den Tieren stumpfe Metallhaken in die Blaslöcher treiben und sie auf den Strand ziehen. Mit scharfen Messern werden die Wirbelsäule und die Hauptarterien durchtrennt, so dass die Tiere langsam verbluten.
Diese Jagdmethode ist besonders grausam, da die Tiere von Beginn des Treibens bis zur brutalen Tötung auf dem Strand enormem Stress ausgesetzt sind. Zudem unterliegen die Treibjagden keinen internationalen Kontrollen, denn Dänemark erkennt keine Zuständigkeit internationaler oder regionaler Abkommen gegenüber den Kleinwaljagden an und auch die Internationale Walfangkommission fühlt sich für diese barbarischen Jagden nicht verantwortlich.
Kürzlich berichteten viele Medien über das aktuellste Drama, das sich vor den Färöer Inseln ereignete: An nur einem Wochenende wurden vor den Färöer-Inseln 1428 Delfine getötet. Die Massentötung der Weißseitendelfinen löste eine intensive Tierschutzdebatte aus.
Save the Ocean ist ein länderübergreifendes Bündnis von Tierschützern, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Menschen über Tierschutz und den Raubbau an der Natur aufzuklären und hatte in Duisburg, Paris, Malta, Griechenland, Athen und in Holland bereits mehrere aufsehenerregende Aktionen, mit denen auf die untragbaren Zustände für die Meeressäuger hingewiesen wurde, worüber auch die deutsche und internationale Presse berichtete.
Mehrere prominente Tierschützer wie beispielsweise die deutschen Schauspielerinnen Tessa Mittelstaedt (Tatort, SOKO uvm.) und Leonie Mirow, die italienische EU-Abgeordnete Eleonora Evi (Europa Verde), der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi (Die Linke), der bekannte Tierrechtler und ehemalige MdEP Stefan Bernhard Eck sowie Jürgen Ortmüller (Gründer des WDSF, laut Handelsblatt einer der bekanntesten Tierschützer Deutschlands) unterstützen die Forderungen von Save the Ocean nach einer umgehenden Beendigung der brutalen Tötungen der Meeressäuger auf den Färöer Inseln.
Jörn Kriebel, Gründer und Vorsitzender der Privat-Initiative „Save the Ocean“: „Es ist ein starkes Zeichen, dass sich prominente Tierschützer für unsere Forderungen des Stopps der grausamen Waljagd auf den Färöer Inseln aussprechen. Es ist absolut notwendig, dass jeder Einzelne seine Stimme erhebt gegen das Unrecht, was diesen intelligenten, sanftmütigen Meeressäugern widerfährt. Grindadráp ist absolut unnötig und überdies legalisierte Tierquälerei. Es ist allerhöchste Zeit, dass die Färöer endlich mit der „Tradition“ der Waljagd brechen!“
Die Wahrheit über den Walfang auf den Färöer-Inseln
In einem neuen Bericht widerlegen sieben führende Organisationen für Tier- und Meeresschutz die Behauptungen von Waljägern, dass die jährlichen Treibjagden auf den Färöer-Inseln human, nachhaltig und ein wesentlicher Teil der lokalen Kultur sind. Dies erfolgt im Kontext der jüngsten Treibjagd auf den Färöer-Inseln, bei der am 22. September 2023 42 Grindwale getötet wurden.
Mit dieser jüngsten Jagd erhöht sich die Gesamtzahl der auf den Inseln getöteten Wale und Delfine auf über 900 – weit über dem üblichen Durchschnitt von etwa 685 Tieren.
Die fortgesetzte Jagd auf Grindwale auf den Färöer-Inseln: Eine kritische Untersuchung
Der Bericht “Die Wahrheit ans Licht bringen: Walfang auf den Färöer-Inseln” untersucht kritisch die Hauptargumente für die fortgesetzte Jagd auf Langflossen-Grindwale und andere Kleinwale auf den Färöer-Inseln (ein kleines selbstverwaltetes dänisches Territorium zwischen Schottland und Island im Nordatlantik) anhand von evidenzbasierten Argumenten. Die Jagd, bekannt als Grindadráp, wird von der internationalen Gemeinschaft weitgehend verurteilt. Obwohl die Jagd zu Wikingerzeiten mit Ruderbooten durchgeführt wurde, wird die Hetzjagd heute mit Motorbooten und Jetskis und modernster Kommunikationstechnologie durchgeführt. Ein Entkommen ist praktisch unmöglich. Am Freitag, dem 22. September, wurden 42 Grindwale getötet, was die Gesamtzahl auf über 900 Wale und Delfine erhöht. In den letzten zehn Jahren haben färingische Walfänger durchschnittlich 660 Grindwale und 133 Delfine pro Jahr getötet. Das Fleisch wird an interessierte Inselbewohner verteilt und manchmal in Lebensmittelgeschäften und Restaurants verkauft. Vor dieser jüngsten Jagd waren bis August 2023 bereits 854 Grindwale getötet worden. Im September 2021 starben auf den Färöer-Inseln an einem einzigen Tag mehr als 1.400 Atlantische Weißseitendelfine, was zu einem großen öffentlichen Aufschrei und scharfer Kritik seitens der Europäischen Union führte.
Die grausame Realität der Treibjagden: Ein Blick auf die Methoden
Wenn eine Schule von Walen oder Delfinen gesichtet wird, treiben die Jäger sie mit einer Reihe von Booten an die Küste und in ausgewiesene Tötungsbuchten. Sobald die Tiere im seichten Wasser sind, werden sie mit einem Rundhaken gesichert, der in die Blaslöcher – die Atemwege der Wale – getrieben wird, und an Land gezogen. Dort wird jeder einzelne Wal oder Delfin mit einem Messer oder einer scharfen Wirbelsäulenlanze getötet, die in den Hals hinter dem Blasloch gestoßen wird. Dies kann das Tier lähmen, bedeutet aber nicht unbedingt, dass es sofort tot, bewusstlos oder schmerzunempfindlich ist.
“Es ist unmöglich, Grindwal- oder Delfingruppen auf humane Weise an die Küste zu treiben, zu sichern und zu töten. Diese Treibjagden sind extrem stressig und schmerzhaft, die Tiere müssen zusehen, wie andere Mitglieder ihrer Gruppe getötet werden, bevor sie selbst das gleiche Schicksal erleiden”, beschreibt Dr. Sandra Altherr, Mitbegründerin von Pro Wildlife, das Massenschlachten.

“Es ist für uns sehr schwer nachzuvollziehen, warum die grausame und unnötige Treibjagd auf Wale und Delfine auf den Färöer-Inseln immer noch fortgesetzt wird. An allen anderen Orten, an denen es solche Aktivitäten gab, mit Ausnahme von Japan, wurde diese inhärent unmenschliche Praxis beendet”, betont Fabienne McLellan, Geschäftsführerin von OceanCare. “Wir sind zutiefst besorgt darüber und hoffen, dass dieser neue Bericht dazu beiträgt, einige der Missverständnisse auszuräumen, die auf den Inseln und anderswo bestehen.”
Die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts:
-Auch wenn viele Färinger mit Verweis auf die Tradition Grindwale jagen und essen, zeigt der neue Bericht, dass die Mehrheit der Färinger weder am Walfang teilnimmt noch das Fleisch konsumiert. Auch die Jagd auf die kleineren Delfinarten stößt bei den Einheimischen auf erheblichen Widerstand. So ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstitutes Gallup vom April 2022, dass 69 Prozent der Öffentlichkeit die Delfinjagd ablehnen, während nur 7 Prozent sie befürworten.
Obwohl die Befürworter der Grindwaljagd argumentieren, Fang und Tötung seien human, kam eine kürzlich in der Fachzeitschrift Frontiers in Veterinary Science veröffentlichte Untersuchung zu dem Schluss, dass die färingischen Jagdtechniken angesichts des aktuellen Wissens über die empfindungsfähige Natur dieser Tiere ethisch und moralisch inakzeptabel sind.
-Behauptungen, die Treibjagden seien nachhaltig, vereinfachen ein komplexes Thema grob und berücksichtigen weder die niedrige Vermehrungsrate von Grindwalen noch die Folgen einer Jagdmethode, die ganze soziale Einheiten vernichtet.
-Trotz der langen Tradition der Grindwaljagd auf den Färöern (die oft als kulturelle Rechtfertigung für die Tötung vorgebracht wird) nimmt die Mehrheit der Färinger heute weder am Walfang teil, noch konsumieren sie das Fleisch. Heutzutage werden für die Jagd moderne motorisierte Schiffe und hochentwickelte Kommunikationstechniken eingesetzt, womit die Jagd längst nicht mehr historischen oder traditionellen Methoden entspricht.

Waljagd auf Suðuroy
In der vergangenen 24.05.2022 Nacht wurde auf der färöischen Insel Suðuroy eine Waljagd ausgerufen, die mit dem Tod von 119 Grindwalen endete. Trotz ihrer verzweifelten Versuche, dem brutalen Schicksal zu entkommen, verloren diese intelligenten Meeressäuger den Kampf. Die Sea Shepherd-Crew, bekannt für ihren Einsatz zum Schutz der Meeresbewohner, dokumentierte den gesamten Vorgang.
Die grausamen Bilder, die an diesem Tag entstanden, zeigen die Zerstückelung der Grindwale und die Verteilung ihres Fleisches unter den Bewohnern des Gebiets. Die Szenen verdeutlichen die anhaltende Problematik der traditionellen Waljagd auf den Färöer-Inseln, die weltweit auf Kritik stößt.
Die Traurigkeit und das Entsetzen, die mit solchen Handlungen einhergehen, sind unbeschreiblich. Es ist erschütternd zu sehen, wie die Überreste dieser großartigen Tiere nach der Jagd wieder ins Meer geworfen werden – ein Anblick, der viele Menschen, die sich für den Schutz der Ozeane einsetzen, zutiefst bewegt und schockiert.
In einer Zeit, in der der Schutz unseres Planeten und seiner Bewohner dringender ist als je zuvor, stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit und Rechtfertigung solcher Jagden umso eindringlicher. Die Färöer werden aufgefordert, ihre Traditionen zu überdenken und eine moderne, respektvolle Beziehung zu den Meeren und ihren Lebewesen zu entwickeln.
Die Jagd auf Grindwale bleibt ein kontroverses Thema, das nicht nur eine ökologische, sondern auch eine ethische Dimension hat. Während einige die kulturelle Bedeutung dieser Praxis betonen, fordern viele internationale Organisationen und Aktivisten, darunter Sea Shepherd, ein sofortiges Ende dieser grausamen Tradition.
Massentötung von Weißseitendelfinen auf den Färöer-Inseln
Am Sonntag, den 12. September 2021, fand eine der größten Massentötungen von Meeressäugern in der Geschichte der Färöer-Inseln statt. Medienberichten zufolge wurden 1428 Weißseitendelfine im Skálafjord getötet – eine schockierende Zahl, die sowohl Umweltschützer als auch Teile der lokalen Bevölkerung erschütterte.
Die Jagd, bekannt als „Grindadrap“, ist eine jahrhundertealte Tradition auf den autonomen, zum dänischen Königreich gehörenden Inseln im Nordatlantik. Ursprünglich diente sie der Versorgung mit Fleisch und Tran, doch ihre Praktiken und die anhaltende Jagd auf Wale und Delfine werden zunehmend international kritisiert.
Selbst innerhalb der Färöer-Gemeinschaft sorgte das Ausmaß dieses Ereignisses für kontroverse Diskussionen. Der ehemalige Vorsitzende der färöischen Vereinigung für den Grindwalfang äußerte, dass die Tötung einer solch großen Anzahl an Delfinen übertrieben sei. Der aktuelle Leiter der Vereinigung zeigte sich besorgt über den Ruf der Inseln, der durch solche Aktionen zunehmend Schaden nehmen könnte.
Viele Menschen, darunter auch Augenzeugen, prangerten die Jagd als grausam und unnötig an. Ein Nutzer beschrieb die Delfinschule als etwas Schönes, das man bewundern sollte, statt sie auf einen blutgetränkten Strand zu treiben. Berichten zufolge verursachte die Jagd großes Tierleid, was den internationalen Druck auf die Färöer-Inseln erhöht, diese Tradition zu überdenken.
Historisch betrachtet geht der Grindwalfang auf die Wikingerzeit zurück. Die Tiere werden von Schiffen und Booten in flache Buchten getrieben, wo sie geschlachtet und das Fleisch an die Teilnehmer verteilt wird. Während in den letzten Jahren hauptsächlich Grindwale erlegt wurden, zeigt die außergewöhnlich hohe Zahl von getöteten Weißseitendelfinen im Jahr 2021 eine drastische Zunahme dieser Praxis. Zum Vergleich: 2020 wurden 576 Grindwale und lediglich 35 Weißseitendelfine getötet.

Die Massentötung von 1428 Delfinen stellt einen neuen Höhepunkt der Kontroverse um den Grindadrap dar. Sie wirft dringende Fragen zur ethischen und ökologischen Vertretbarkeit dieser Tradition auf, insbesondere in einer Zeit, in der der Schutz der Ozeane und ihrer Bewohner wichtiger ist denn je.

Brutale Massentötung von Delfinen auf den Färöer-Inseln
In der Nacht vom 26. Juni 2021 ereignete sich eine erschütternde Tragödie auf den Färöer-Inseln. Eine Delfinfamilie wurde über Stunden hinweg mit Booten in Panik versetzt, absichtlich gerammt und schließlich erschöpft an den Strand von Vestmannasundi getrieben. Dort wurden die Tiere auf grausamste Weise getötet. Berichten zufolge stach eine Menge, angeheizt von Hass und Gewaltbereitschaft, den Delfinen mit Dolchen die Wirbelsäulen auf und schnitt ihnen die Nacken durch – eine Methode, die unsägliche Qualen verursacht.
Die Bilder und Augenzeugenberichte dieses Blutsports rufen weltweit Entsetzen hervor. Der Vorfall steht exemplarisch für die Kontroverse um den traditionellen „Grindadrap“, bei dem Wale und Delfine getötet werden. In diesem Fall war es jedoch weniger eine Frage von Tradition, sondern eine systematische „Beseitigung“ von Delfinen, die angeblich eine Konkurrenz für die Fischerei darstellen.
Kulturelle Praxis oder ökologisches Verbrechen?
Während sich Befürworter des Grindadrap auf kulturelle Traditionen berufen, die bis in die Wikingerzeit zurückreichen, stellt sich die Frage, ob diese Praktiken in der heutigen Zeit noch gerechtfertigt sind. Kritiker werfen den Färöern vor, dass diese Massenjagden längst keine Tradition mehr sind, sondern von wirtschaftlichem Interesse und der Kontrolle über die Fischbestände getrieben werden. Besonders brisant ist der Vorwurf, dass Delfine systematisch als Konkurrenz der riesigen Fischereiindustrie eliminiert werden.
Grausamkeit und fehlendes Mitgefühl
Die Berichte von Augenzeugen schildern eine Szene des Hasses und der Gewalt, die nicht nur international, sondern auch innerhalb der Färöer-Gemeinschaft für Empörung sorgt. Während eine Minderheit der Färöer-Inselbewohner solche Grausamkeiten ablehnt, schweigen viele aus Angst vor Repressionen und sozialem Druck. Der Vorfall zeigt, dass die Jagd nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus moralischer Sicht fragwürdig ist.
Gesundheitliche und ökologische Auswirkungen
Ein weiterer Punkt der Kritik ist der Umgang mit dem Fleisch der getöteten Tiere. Das hochgiftige Fleisch, das oft gesundheitsschädliche Mengen an Quecksilber und anderen Schadstoffen enthält, wird teils konsumiert, teils entsorgt. Ganze Delfinkadaver – einschließlich der von Jungtieren – werden auf speziellen Rutschen wieder ins Meer geschoben, ein Symbol für die Sinnlosigkeit dieser Massenmorde.
Appell an die internationale Gemeinschaft
Solche Verbrechen an Meeressäugern dürfen nicht unbeachtet bleiben. In Ländern wie der Schweiz, den USA und der EU wäre die Zerstückelung von Delfinen auf diese Weise mit hohen Strafen belegt. Es bleibt unverständlich, warum die internationale Politik in Fällen wie diesem schweigt. Der Grund für diese Jagden liegt weniger in der Nutzung des Fleisches als vielmehr in der Vorstellung, Delfine seien Konkurrenten im Wettstreit um Fischbestände.
Fazit
Die Massenmorde an Delfinen auf den Färöer-Inseln und in Japan sind Ausdruck einer rückwärtsgewandten Denkweise, die in einer modernen, umweltbewussten Gesellschaft keinen Platz haben sollte. Jeder, der behauptet, Delfine zu lieben, ist aufgerufen, für sie einzutreten und diese Taten öffentlich zu verurteilen. Schweigen bedeutet Zustimmung, und diese grausamen Verbrechen dürfen nicht im Verborgenen geschehen.
Färöer-Inseln als Symbol für Tierleid – Pilotwalkopf auf Angelhakenskulptur in Klaksvík
Am 29. April 2021 sorgte ein makaberer Vorfall auf den Färöer-Inseln für weltweite Aufmerksamkeit. In Klaksvík, der zweitgrößten Stadt der Inselgruppe, wurde der blutige Kopf eines Pilotwals absichtlich auf einer riesigen Angelhakenskulptur angebracht. Diese Aktion folgte auf den ersten „Grindadráp“ des Jahres, bei dem zehn Pilotwale gnadenlos getötet wurden.
Die Skulptur, ursprünglich als Symbol für die Verbundenheit der Färöer mit der Fischerei errichtet, wurde durch die Anbringung des Walkopfs zum Sinnbild für die Grausamkeit und die umstrittene Waljagd auf der Inselgruppe. Kritiker sehen darin eine verstörende Demonstration von Gewalt und Missachtung gegenüber diesen intelligenten Meeressäugern.
Der Grindadráp – eine umstrittene Tradition
Die Waljagd, bekannt als „Grindadráp“, hat auf den Färöer-Inseln eine jahrhundertealte Tradition. Die Tiere werden in flache Buchten getrieben, wo sie von den Jägern mit Messern getötet werden. Das Fleisch wird anschließend unter den Teilnehmern aufgeteilt. Befürworter verteidigen diese Praxis als Teil ihrer kulturellen Identität und Selbstversorgung.
Doch zunehmend wird diese Tradition von internationalen Umweltorganisationen, Tierschützern und auch Teilen der lokalen Bevölkerung infrage gestellt. Der Grindadráp steht für viele als Symbol für unnötige Grausamkeit und Tierleid in einer Zeit, in der alternative Proteinquellen und ein wachsendes Bewusstsein für den Schutz der Meereswelt vorhanden sind.
Ein Symbol für Schande und Kritik
Der Pilotwalkopf auf der Angelhakenskulptur von Klaksvík wird von vielen als Schandfleck und als Zeichen für die Unmenschlichkeit dieser Tradition gesehen. Es zeigt, wie stark die Meinungen zur Waljagd auf der Inselgruppe auseinandergehen. Kritiker werfen den Färöern vor, durch diese Praktiken nicht nur das Tierwohl zu ignorieren, sondern auch ihren internationalen Ruf zu gefährden.

Ein Appell an die Färöer und Europa
Die Wal- und Delfinjagd auf den Färöer-Inseln gehört zu den am heftigsten kritisierten Praktiken in Europa. Die grausamen Szenen und das offensichtliche Tierleid werfen die Frage auf, wie solche Traditionen in einer modernen Welt fortbestehen können. Die Färöer-Inseln stehen am Scheideweg: Bleiben sie ein Symbol für Tierquälerei, oder finden sie Wege, ihre Traditionen zu bewahren, ohne dabei Leid und Zerstörung zu verursachen?
Es liegt an der internationalen Gemeinschaft, an Regierungen und an jedem Einzelnen, den Druck aufrechtzuerhalten, um den Schutz der Meeresbewohner und einen respektvolleren Umgang mit der Natur zu fördern. Der Vorfall in Klaksvík ist ein Mahnmal für die Grausamkeit, die sich in den Gewässern des Nordatlantiks abspielt – und ein Aufruf, nicht länger zu schweigen.

Brutale Treibjagd auf Grindwale in Hvannasund, Färöer-Inseln
Am 28. April 2021 wurde eine Gruppe von etwa 10 bis 12 Grindwalen (Pilotwalen) in Hvannasund, einem kleinen Ort auf den Färöer-Inseln, brutal getötet. Unter den Opfern befanden sich Berichten zufolge auch trächtige Weibchen, die durch die gewaltsame Treibjagd ihr Leben verloren.
Die Tiere, die friedlich in den Gewässern des Nordatlantiks lebten, wurden in die Bucht von Hvannasund getrieben, wo sie einer grausamen Tradition zum Opfer fielen. Der „Grindadráp“, wie diese Form der Waljagd auf den Färöer-Inseln genannt wird, wird von internationalen Tierschützern seit Jahren heftig kritisiert.
Grausamkeit ohne Notwendigkeit
Obwohl die Jagd auf Wale
und Delfine von den Färingern oft mit kulturellen und traditionellen Argumenten verteidigt wird, zeigt sich immer deutlicher, dass der Verzehr des Fleisches in der heutigen Zeit nicht mehr notwendig ist. Die Färöer sind längst nicht mehr auf Wal- oder Delfinfleisch angewiesen, da ihre wirtschaftliche und kulinarische Basis eine Vielzahl alternativer Ressourcen bietet. Die Tötungen erscheinen somit sinnlos und werden von vielen als Ausdruck krankhafter Freude am Töten beschrieben.
Kulturelle Tradition oder unhaltbare Praxis?
Während Befürworter die Jagd als fest verwurzelten Bestandteil ihrer Identität ansehen, steht die Praxis immer stärker in der Kritik. Der „Grindadráp“ ist nicht nur extrem grausam – die Tiere werden mit Messern getötet, oft unter unsäglichen Qualen –, sondern auch ökologisch und ethisch fragwürdig. Die Bilder von blutgetränkten Stränden und leidenden Tieren sorgen weltweit für Empörung.
Appell an die Färöer und die internationale Gemeinschaft
Es ist Zeit, die Legitimität solcher Praktiken im Kontext einer modernen Welt zu hinterfragen. Der Schutz der Meere und ihrer Bewohner ist angesichts der globalen Klimakrise und des Artensterbens wichtiger denn je. Die Fortsetzung des Grindadráp sendet ein fatales Signal: eine Missachtung des Lebens und der Biodiversität unserer Ozeane.
Die Färöer-Inseln stehen unter wachsendem Druck, ihre Traditionen zu überdenken und sich dem globalen Bewusstsein für Tierschutz und Umweltschutz anzupassen. Es liegt an der internationalen Gemeinschaft, den Dialog zu fördern und die Färöer dazu zu bewegen, sich für eine Zukunft zu entscheiden, die von Respekt vor dem Leben und der Natur geprägt ist.
Blutbad am Rande Europas! Fast 100 Wale in nur 12 Minuten grausam abgeschlachtet
Es sind schreckliche Bilder. Das Meer und der Strand färbte sich rot vom Blut. Die 100 Wale, darunter vier Kälber und mindestens fünf schwangere Wale hatten keine Chance. Sie wurden brutal abgeschlachtet. Schreckliche Aufnahmen zeigen, wie die Grindwale mit klaffenden Wunden am Hinterkopf grausam verendet sind. Nicht mal kleine oder schwangere Wale wurden verschont. Mit Haken und Messern durchtrennten sie das Rückenmark der schönen, zutraulichen Grindwale. Die Färöer-Inseln, 200 Meilen nördlich von Schottland und zu Dänemark gehörend, töten trotz weltweitem Protest, weiterhin Wale.
Das passiert zurzeit in Europa – es ist Dänemark – nicht Japan! Insgesamt 94 langflossige Grindwale , darunter vier Kälber und mindestens fünf schwangere Grindwale wurden an Land gezogen und am Strand der Stadt Vestmanna getötet.
„Das Töten dauerte ungefähr 12 Minuten, wobei die gestressten und erschöpften Pilotwale jeden Alters wahllos vor den Augen ihrer Familienmitglieder getötet wurden, bis alle im blutroten Sand von Vestmanna tot waren“, gab Sea Shepherd bekannt.
Fotos, die die Wohltätigkeitsorganisation auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht hat, zeigen ungeborene Babywale, die sich noch in ihren Fruchtbläschen befinden, und andere Fotos zeigen die Kadaver geschlachteter Wale, die von großen Baggern ins Meer zurück geworfen wurden.
Sea Shepherd appelliert an Kreuzfahrtunternehmen, sich öffentlich gegen die Tötung von rund 850 Grindwalen und Delfinen durch die Färöer auszusprechen.
Die Schlachtung in Vestmanna ist die elfte Jagd auf den Färöern in diesem Jahr – mit mehr als 600 Pilotwalen, die 2019 geschlachtet wurden.
Kapitän Paul Watson, Gründer von Sea Shepherd, und Rob Read, Chief Operating Officer, sagten, dass die Jagden „jederzeit in einer der 26 ausgewiesenen Tötungsbuchten auf den Färöern stattfinden können…. Ohne Saison, ohne Quote, ohne wirksame Regulierung und trotz stark kontaminiertem Walfleisch.
Jedes Jahr werden auch Hunderte von Walen auf den Inseln getötet, die zu Dänemark gehören, aber ein autonomes Land sind und daher nicht an die Gesetze Dänemarks oder der Europäischen Union gebunden. Nach Regierungsangaben leben dort rund 50.000 Menschen.
Gemäß den färöischen Vorschriften müssen die Wale so schnell wie möglich getötet werden und Leid soll ihnen erspart bleiben. Doch wie soll das funktionieren?

Grindadráp ist die unerträgliche „Tradition“ der Grindwaljagd auf den Färöer-Inseln. Jahr für Jahr wiederholt sich ein blutiges Schauspiel am nördlichen Rande Europas.
Nähert sich eine Schule von Grindwalen, ein Familienverband von teilweise über hundert Tieren, der Küste und wird von den färingischen Fischern entdeckt, verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Die Fischer fahren mit ihren Booten aufs Meer, kreisen die Wale ein und treiben sie in Richtung einer ausgewählten Bucht. Was nun folgt, ist ein schreckliches Abschlachten der Wale und dieses schreckliche Schauspiel ist erlaubt! Obwohl international immer wieder scharf gegen das jährliche Blutbad protestiert wird, konnte das Töten bisher nicht verhindert werden.
„Das Fleisch und die Walwurst von Grindwalen waren und sind ein wichtiger Teil der nationalen Ernährung auf den Färöern“, heißt es in der Erklärung. “ In einer Stellungnahme beschrieb die färöische Regierung den Walfang als „natürlichen Teil des färöischen Lebens“ und wies Vorwürfe zurück, dass die Morde rituell oder leichtfertig seien.
Jedes Jahr werden laut Sea Shepherd direkt vor unserer europäischen Haustür alljährlich durchschnittlich etwa 1000 Meeressäuger auf den Färöer-Inseln, die nördlich von Großbritannien im Nordatlantik zwischen Norwegen und Island direkt am Golfstrom liegen, an Strandabschnitten getötet.
Nicht nur die rapide ansteigende Verschmutzung der Weltmeere, die zunehmende Schifffahrt, die Lärmemission (Tiefseesonare, Bohrungen oder die Suche nach Gas- und Ölvorkommen mittels Druckluftkanonen, die Schallwellen auslösen, welche die empfindlichen Sinnesorgane der Tiere irritieren und ihnen die Orientierung nehmen) rotten diese Meeressäugetiere aus, auch die brutalen Fangmethoden treiben Wale qualvoll in den Tod.

Grausames Massaker an Walen und Delfinen auf den Färöer-Inseln ruft weltweite Empörung hervor
29.07.2017 In den Sommermonaten wiederholt sich auf den Färöer-Inseln eine grausame Tradition, die das Meer rot färbt und global auf scharfe Kritik stößt. Jährlich werden etwa 1.000 Wale und Delfine im Rahmen des sogenannten „Grindadráp“, eines jahrhundertealten Rituals, brutal getötet.
Die Praxis geht bis ins Jahr 1584 zurück und wird von den Einheimischen als kulturelles Erbe verteidigt. Doch immer mehr Menschen weltweit stellen die Legitimität dieser „Tradition“ infrage. Bilder von blutigen Stränden und leidenden Meeressäugern verbreiten sich in sozialen Medien und entfachen eine Welle der Empörung.
Die Methode der Jagd – ein Ritual der Grausamkeit
Die Jagd erfolgt, indem Fischer die wandernden Wale und Delfine in Booten umzingeln und sie an die Küste treiben. Dort stranden die Tiere und werden mit grausamen Methoden getötet. Berichte von Organisationen wie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) beschreiben das erschreckende Ausmaß des Leidens:
- Metallhaken werden in die Atemlöcher der gestrandeten Tiere getrieben.
- Die Rücken werden aufgeschlitzt, und die Wale verbluten langsam.
- Ganze Familien von Meeressäugern werden getötet, während einige Tiere im Blut ihrer Angehörigen schwimmen müssen.
Diese beschriebene Brutalität hat weltweit für Entsetzen gesorgt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Wale und Delfine hochintelligente Wesen sind, die Schmerz und Angst ähnlich intensiv empfinden wie Menschen.
Die Verteidigung der Färöer-Inseln
Trotz der weltweiten Kritik verteidigen die Färöer-Inseln ihre Praktiken. Ein Sprecher der Inseln, Páll Nolsøe, erklärte, dass das Grindadráp ein natürlicher Bestandteil des Lebens auf den Färöer-Inseln sei. Das Fleisch und der Speck der Grindwale würden als wertvolle Nahrungsergänzung geschätzt.
Die färöische Regierung betont zudem, dass der Walfang in Übereinstimmung mit internationalen Gesetzen und Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung durchgeführt werde. Kritiker stellen diese Aussage jedoch infrage, da der kommerzielle Walfang in den meisten Teilen der Welt verboten ist und die ökologische Notwendigkeit solcher Jagden längst überholt scheint.
Ein globaler Aufruf zum Handeln
Die verstörenden Bilder und Berichte über das Grindadráp haben eine breite Diskussion über den Schutz von Meeressäugern und die Grenzen kultureller Traditionen ausgelöst. Viele internationale Organisationen, darunter PETA, fordern ein sofortiges Ende dieser grausamen Praktiken.
Das Grindadráp mag eine jahrhundertealte Tradition sein, doch in einer Zeit, in der der Schutz der Meere und ihrer Bewohner von entscheidender Bedeutung ist, erscheint diese Praxis als Anachronismus. Die Färöer-Inseln stehen vor der Herausforderung, sich ihrer globalen Verantwortung zu stellen und alternative Wege zu finden, um Tradition und Tierwohl in Einklang zu bringen.
Die Welt sieht hin – und die Stimmen für ein Ende des Grindadráp werden lauter.
Walfang auf den Färöer-Inseln: Wieder mussten 41 Tiere qualvoll sterben
Der 7. November war erneut ein blutiger Tag auf den Färöer-Inseln.Beim Grindadráp, dem Zusammentreiben und Töten von Grindwalen (Globicephala melas) wurde eine vorbeiziehende Walfamilie mit Motorbooten an die Bucht Leynar getrieben und dort im blutgetränkten Meer getötet. 41 Wale wurden abgeschlachtet. Seht hier das Video.
Obgleich die Färöer-Inseln zu Dänemark gehören und der Walfang in der EU veboten ist, gelten für die Färöer Inseln eigene Gesetze und ein Walfangverbot ist nicht in Sicht. Bereits im Juli und im August wurden bei mehreren Fangaktionen Grindwale getötet. Laut Statistik wurden dieses Jahr bereits knapp 300 Meeressäuger umgebracht.
So grausam werden die Wale getötet
Den in die Bucht getriebenen Grindwalen werden Metallhaken in die Blaslöcher gerammt, dann wird ihnen das Rückgrat durchtrennt. Viele Tiere verbluten langsam, andere schwimmen panisch vor Angst im Blut ihrer Familienangehörigen. Alles im Namen der „Tradition“.

Nicht tolerierbar: Dänemark und die EU sehen stillschweigend zu
Weder die Regierung von Dänemark noch die verantwortlichen Politiker der EU greifen ein und versuchen die Jagd auf die intelligenten, sozialen und friedlichen Meeressäuger zu unterbinden.

Metal-Band „Týr“ unter Beschuss – Central in Weinheim sagt Auftritt ab
Am 3. September 2016 wurde bekannt, dass das Café Central in Weinheim den geplanten Auftritt der färöischen Metal-Band „Týr“ abgesagt hat. Der Grund: Der Frontmann der Band, Heri Joensen, ist ein aktiver Teilnehmer an den Grindwaljagden („Grindadráp“) auf den Färöer-Inseln. Diese Praxis, die international scharf kritisiert wird, führte zu einem massiven öffentlichen Protest und schließlich zur Entscheidung des Veranstaltungsortes, die Band auszuladen.
Die Kritik und die Reaktionen
Die Veranstalter des Café Central erklärten am 19. August auf ihrer Facebook-Seite, dass sie nach Bekanntwerden der Aktivitäten von Heri Joensen keine Plattform für die Band bieten wollen. Sie schrieben:
„Das hat mit unserem Selbstverständnis nichts zu tun und kann auch nicht mit ‚Tradition‘ begründet werden. Wir leben im Jahr 2016, und Traditionen sind ja bekanntlich dazu da, auch mal gebrochen zu werden. Think about it!“
Dieser Beitrag wurde über 700 Mal geliked, zig Mal geteilt und mit zahlreichen Kommentaren unterstützt. Viele lobten das Café für die klare Haltung gegen die Unterstützung von Walfang.
Die Rolle des WDSF
Ausgelöst wurde der Protest vom
Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF), das nach Bekanntgabe der Europatour von „Týr“ Musikclubs aufforderte, die Band auszuladen. Das WDSF wies auf die Verbindung von Joensen zur Grindwaljagd hin und kritisierte, dass er „die Abschlachtungen in den Songs der Band verherrlichen würde“.
Hintergrund der Grindwaljagd
Die Grindwaljagd, eine Jahrhunderte alte Tradition auf den Färöer-Inseln, ist international hoch umstritten. Die Praxis sieht vor, dass Grindwale in Buchten getrieben, dort an Land gezogen und brutal geschlachtet werden. Dabei färbt sich das Wasser blutrot, und die Bilder, die im Internet kursieren, sorgen regelmäßig für Entsetzen.
Obwohl die Einwohner der Färöer-Inseln sich auf ihre Tradition berufen und behaupten, dass der Grindwalfang strengen Regeln unterliegt, argumentieren Tierschützer wie Sea Shepherd und das WDSF, dass diese Praktiken grausam und unnötig sind. Moderne Lebensbedingungen ermöglichen den Einwohnern längst, ihren Bedarf an Nahrung aus Supermärkten zu decken.
Die Debatte um „Týr“
Die Metal-Band „Týr“ sieht sich nicht zum ersten Mal der Kritik ausgesetzt. Bereits 2014 hatte Sänger Heri Joensen mit einem Facebook-Post über sein Essen – Walfleisch – einen Shitstorm ausgelöst. Während die Band weltweit Fans hat (über 250.000 Follower auf Facebook), zeigt der aktuelle Boykott, dass ihre Verbindung zur Grindwaljagd in Europa zunehmend auf Ablehnung stößt.
Ein emotionales Thema
Die Diskussion um die Grindwaljagd ist emotional aufgeladen, besonders in sozialen Medien. Während die Mehrheit die Praxis strikt ablehnt und den Boykott der Band unterstützt, gibt es auch einige Stimmen, die diese Verknüpfung von Musik und Walfang kritisieren. Ein Facebook-Kommentar bringt diese Perspektive auf den Punkt:
„David Bowie wäre kein schlechterer Musiker gewesen, wenn er Wale gejagt hätte. [...] Blöde Verquickung.“
Fazit
Die Absage des Auftritts von „Týr“ im Café Central ist ein weiteres Zeichen dafür, dass das Bewusstsein für Tier- und Umweltschutz wächst. Während die Band trotz der Kontroversen weiter Fans gewinnt, zeigt der Fall auch, wie stark kulturelle Traditionen und moderne Werte aufeinanderprallen.
Wer die Verlierer sind, ist jedoch eindeutig: Es sind die Tiere. Und wie so oft zahlen sie den höchsten Preis.