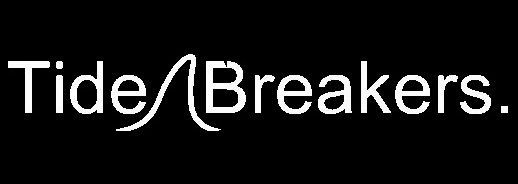Färöern-Inseln
Das blutige Wal-Massaker auf den Färöer-Inseln
Die Färöer-Inseln, eine autonome Inselgruppe im Nordatlantik, gehören zwar zu Dänemark, haben jedoch ihre eigenen Gesetze und eine blutige Tradition, die weltweit für Entsetzen sorgt. Jedes Jahr werden dort im Rahmen der sogenannten „Grindadráp“ Hunderte bis Tausende Grindwale (Pilotwale), Schnabelwale und Delfine brutal abgeschlachtet.
Die Methode des Abschlachtens
Mit Hilfe moderner Motorboote werden die Meeressäuger in enge Buchten getrieben, wo ihnen ein grausames Schicksal bevorsteht. Sobald die Tiere gestrandet sind, werden Metallhaken in ihre Blaslöcher gerammt, um sie zu fixieren. Anschließend wird das Rückgrat der Tiere durchtrennt. Dabei verbluten sie langsam, während sie unsägliche Schmerzen erleiden. Ganze Familienverbände fallen diesem Massaker zum Opfer.
Ein besonders herzzerreißender Anblick sind die panischen Tiere, die stundenlang im Blut ihrer getöteten Artgenossen schwimmen und verzweifelt versuchen, ihre Angehörigen zu retten. Diese grausame Tradition schockiert vor allem durch die Kaltblütigkeit, mit der die Abschlachtung durchgeführt wird.
Rechtslage und internationale Kritik
Obwohl die Färöer-Inseln ein Teil Dänemarks sind, gelten dort autonome Gesetze. Während Dänemark den kommerziellen Walfang eingestellt hat und sich als EU-Mitglied zur Einhaltung des Walfangverbots verpflichtet, ignorieren die Färöer-Inseln diese Vorgaben. Die Grindadráp wird als kulturelle Tradition verteidigt, die angeblich tief in der Geschichte der Inselbewohner verankert ist.
Jedoch gibt es viele Argumente, die diese Praxis infrage stellen:
Keine wirtschaftliche Notwendigkeit: Die Färöer-Inseln sind heute nicht mehr auf Wal- oder Delfinfleisch angewiesen. Es gibt ausreichend Alternativen, um die Bevölkerung zu ernähren.
Umweltbedenken: Das Fleisch der Meeressäuger ist oft mit Quecksilber und anderen Schadstoffen belastet, was eine Gesundheitsgefahr darstellt.
Grausamkeit: Die Art und Weise, wie die Tiere gejagt und getötet werden, wird weltweit als inakzeptabel grausam angesehen.
Forderungen an Dänemark und die EU
Obwohl Dänemark offiziell nicht in die Praktiken der Färöer-Inseln eingreifen kann, wird das Land international dafür kritisiert, die jährlichen Massaker zu tolerieren. Als Mitglied der Europäischen Union, in der der Walfang verboten ist, steht Dänemark in der Verantwortung, stärker auf die Färöer-Inseln einzuwirken, um diese grausame Tradition zu beenden.
Protest und Hoffnung auf Veränderung
Internationale Organisationen und Aktivisten kämpfen seit Jahren gegen die Grindadráp. Demonstrationen, Petitionen und Aufklärungskampagnen haben das Thema weltweit in den Fokus gerückt. Dennoch ist ein Ende der Abschlachtungen bislang nicht in Sicht.
Die grausamen Bilder aus den Buchten der Färöer-Inseln rufen zu einem Umdenken auf: Traditionen, die auf Grausamkeit basieren, haben in der modernen Welt keinen Platz mehr. Es ist an der Zeit, den Tieren die Würde zuzugestehen, die ihnen zusteht, und diese brutalen Praktiken ein für alle Mal zu beenden.
Orca-Jagd und Abschlachtung auf den Färöer-Inseln
Am 18. Juni 1978 ereignete sich in Klaksvík auf den Färöer-Inseln ein erschütterndes Massaker, das bis heute ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Walfangs darstellt. Neben Grindwalen und Delfinen wurden an diesem Tag auch 31 Orcas, die größte Art der Delfine, brutal getötet. Dieses Ereignis, das durch Videoaufnahmen dokumentiert wurde, zeigt die grausame Treibjagd und das Abschlachten einer ganzen Orca-Familie.
Die Jagd auf Orcas – eine brutale Praxis
Wie bei den Grindwalen wurden auch die Orcas mit Motorbooten in eine Bucht getrieben, um dort geschlachtet zu werden. Die gezielte Jagd auf diese majestätischen Meeressäuger zeigt die fehlende Rücksicht auf Tierwohl und Artenschutz. Orcas, bekannt für ihre komplexen sozialen Strukturen und ihre außergewöhnliche Intelligenz, wurden an diesem Tag Opfer einer Tradition, die jegliche Empathie vermissen lässt.
Warum gibt es keinen Schutz für Orcas?
Schwertwale (Orcinus orca) gehören nicht zu den Großwalen, die durch das Walfang-Moratorium der Internationalen Walfangkommission (IWC) von 1986 geschützt werden. Während andere Walarten durch den kommerziellen Walfang stark dezimiert wurden, blieben Orcas von diesen Praktiken weitgehend verschont. Ihre weltweite Population wird auf etwa 50.000 Tiere geschätzt – jedoch fehlen genaue Daten über die Bestände.
Da es keinen internationalen Schutzstatus für Orcas gibt, werden diese Tiere noch immer bejagt und getötet. Neben den Färöer-Inseln ist auch der karibische Inselstaat St. Vincent für die Jagd auf Orcas bekannt. Die Berichte eines Fischers aus Island legen nahe, dass dort ebenfalls Orcas heimlich gejagt und geschlachtet werden – fernab der Küsten, um eine öffentliche Empörung zu vermeiden.
Ein Appell für den Schutz der Orcas
Das Ereignis in Klaksvík im Jahr 1978 und die fortwährenden Jagden auf Orcas zeigen die dringende Notwendigkeit, diese Tiere unter internationalen Schutz zu stellen. Schwertwale spielen eine zentrale Rolle in den marinen Ökosystemen, und ihr Schutz ist nicht nur eine Frage des Artenschutzes, sondern auch der ethischen Verantwortung.
Orcas, wie alle Meeressäuger, verdienen unseren Respekt und Schutz. Die grausamen Traditionen und Praktiken, die das Leben dieser Tiere bedrohen, müssen endgültig der Vergangenheit angehören. Internationale Zusammenarbeit und der Druck von Tierschutzorganisationen sind entscheidend, um Jagden wie die in Klaksvík 1978 zu verhindern und den Orcas ein sicheres Leben in ihren natürlichen Lebensräumen zu ermöglichen.
Prominente gemeinsam mit Save the Ocean gegen Tötungen von Meeressäugern auf den Färöer Inseln
Jedes Jahr fallen auf den Färöer Inseln im Nordatlantik fast tausend Tiere der Jagd zum Opfer - vor allem Grindwale, Delfine, Entenwale und große Tümmler. Bei der als „Grindadráp" bezeichneten Jagd treiben die Bewohner der Färöer Inseln ganze Familienverbände von Walen mit Motorbooten an die Küste und in Buchten und schlachten die Meeressäuger im flachen Wasser ab. Auch trächtige Tiere werden getötet.
Am Strand erwarten die Meeressäuger schon eine Vielzahl von Männern, die den Tieren stumpfe Metallhaken in die Blaslöcher treiben und sie auf den Strand ziehen. Mit scharfen Messern werden die Wirbelsäule und die Hauptarterien durchtrennt, so dass die Tiere langsam verbluten.
Diese Jagdmethode ist besonders grausam, da die Tiere von Beginn des Treibens bis zur brutalen Tötung auf dem Strand enormem Stress ausgesetzt sind. Zudem unterliegen die Treibjagden keinen internationalen Kontrollen, denn Dänemark erkennt keine Zuständigkeit internationaler oder regionaler Abkommen gegenüber den Kleinwaljagden an und auch die Internationale Walfangkommission fühlt sich für diese barbarischen Jagden nicht verantwortlich.
Kürzlich berichteten viele Medien über das aktuellste Drama, das sich vor den Färöer Inseln ereignete: An nur einem Wochenende wurden vor den Färöer-Inseln 1428 Delfine getötet. Die Massentötung der Weißseitendelfinen löste eine intensive Tierschutzdebatte aus.
Save the Ocean ist ein länderübergreifendes Bündnis von Tierschützern, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Menschen über Tierschutz und den Raubbau an der Natur aufzuklären und hatte in Duisburg, Paris, Malta, Griechenland, Athen und in Holland bereits mehrere aufsehenerregende Aktionen, mit denen auf die untragbaren Zustände für die Meeressäuger hingewiesen wurde, worüber auch die deutsche und internationale Presse berichtete.
Mehrere prominente Tierschützer wie beispielsweise die deutschen Schauspielerinnen Tessa Mittelstaedt (Tatort, SOKO uvm.) und Leonie Mirow, die italienische EU-Abgeordnete Eleonora Evi (Europa Verde), der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi (Die Linke), der bekannte Tierrechtler und ehemalige MdEP Stefan Bernhard Eck sowie Jürgen Ortmüller (Gründer des WDSF, laut Handelsblatt einer der bekanntesten Tierschützer Deutschlands) unterstützen die Forderungen von Save the Ocean nach einer umgehenden Beendigung der brutalen Tötungen der Meeressäuger auf den Färöer Inseln.
Jörn Kriebel, Gründer und Vorsitzender der Privat-Initiative „Save the Ocean“: „Es ist ein starkes Zeichen, dass sich prominente Tierschützer für unsere Forderungen des Stopps der grausamen Waljagd auf den Färöer Inseln aussprechen. Es ist absolut notwendig, dass jeder Einzelne seine Stimme erhebt gegen das Unrecht, was diesen intelligenten, sanftmütigen Meeressäugern widerfährt. Grindadráp ist absolut unnötig und überdies legalisierte Tierquälerei. Es ist allerhöchste Zeit, dass die Färöer endlich mit der „Tradition“ der Waljagd brechen!“
Massentötung von 1428 Weißseitendelfinen auf den Färöer-Inseln
Am 2. September 2021 ereignete sich auf den Färöer-Inseln eines der grausamsten und umstrittensten Massaker der jüngeren Geschichte der „Grindadrap“-Tradition. Medienberichten zufolge wurden im Skálafjord unglaubliche 1428 Weißseitendelfine innerhalb eines Abends brutal getötet. Dieses Ereignis hat nicht nur weltweit Empörung ausgelöst, sondern auch die lokale Debatte über die Wal- und Delfinjagd erneut entfacht.
Eine Jagd mit historischen Wurzeln
Die Jagd auf Wale und Delfine, bekannt als „Grindadrap“, geht auf die Wikingerzeit zurück. Seit Jahrhunderten treiben Boote und Schiffe die Tiere in enge Buchten, wo sie geschlachtet werden. Das Fleisch wird anschließend unter den Teilnehmern verteilt. Hauptsächlich richtet sich die Jagd gegen Grindwale, doch gelegentlich werden auch Delfine getötet.
Die Massentötung von 1428 Delfinen im Jahr 2021 stellt jedoch eine Ausnahme dar, sowohl in ihrer Dimension als auch in ihrer Grausamkeit. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2020 wurden 576 Grindwale und 35 Weißseitendelfine getötet – Zahlen, die im Vergleich zu diesem Vorfall nahezu gering erscheinen.
Kritik an der Eskalation der Jagd
Selbst unter den Unterstützern der Grindadrap-Jagd stieß das Ereignis von 2021 auf Kritik. Der ehemalige Vorsitzende der färöischen Vereinigung für den Grindwalfang bezeichnete die Tötung einer so großen Anzahl von Delfinen als „überzogen“. Der heutige Vorsitzende äußerte Bedenken hinsichtlich des internationalen Rufs der Färöer-Inseln.
In den sozialen Medien und in internationalen Berichten wurde die Massentötung heftig kritisiert. Augenzeugen beschrieben das Tierleid als unerträglich. Delfinschulen gelten als sozial stark verbundene Gruppen, die oft panisch versuchen, sich gegenseitig zu retten, was die Brutalität und den Stress der Jagd noch verstärkt.
Warum geht die Jagd weiter?
Die Färöer-Inseln sind weitgehend autonom und rechtfertigen die Grindadrap-Jagd als kulturelle Tradition. Viele Bewohner argumentieren, dass die Jagd nachhaltig sei, da das Fleisch lokal konsumiert wird. Doch Umweltschützer und Wissenschaftler warnen, dass das Fleisch oft mit Schadstoffen wie Quecksilber belastet ist und der Verzehr gesundheitsschädlich sein kann.
Die Tötung von Delfinen in einer solchen Anzahl hat viele Menschen dazu gebracht, die Notwendigkeit dieser Tradition infrage zu stellen. Die internationale Gemeinschaft kritisiert die Jagd als grausam, unnötig und unzeitgemäß.
Ein Wendepunkt in der Debatte?
Die Massentötung von Weißseitendelfinen im Skálafjord könnte ein Wendepunkt in der Debatte über die Wal- und Delfinjagd sein. Der öffentliche Druck wächst, sowohl lokal als auch international, die Praktiken zu überdenken. Tierschutzorganisationen und Aktivisten drängen darauf, die Grindadrap-Tradition zu beenden und einen Schutzstatus für alle Meeressäuger einzuführen.
Dieses Ereignis zeigt erneut die dringende Notwendigkeit, Traditionen zu hinterfragen, die auf Tierleid basieren. Die Welt blickt auf die Färöer-Inseln und fordert einen Wandel, der den Tieren das Leben und die Würde zurückgibt, die sie verdienen.
Grausamer Grindadráp: So werden auf den Färöer-Inseln jährlich hunderte Grindwale geschlachtet
Färinger rücken jährlich zum "Grindadráp" aus Das Meer vor den Färöer-Inseln ist blutrot gefärbt, zahlreiche Menschen schippern auf dem roten Wasser in kleinen Booten zwischen leblosen Walkörpern umher. Beim jährlichen "Grindadráp" rückt die Dorfgemeinschaft beladen mit Messern, Haken, Seilen und Steinen aus, um Jagd auf Grindwale zu machen. Diese werden in seichtes Küstengewässer getrieben, eingekesselt und in Panik versetzt, bis sie schließlich stranden. Dort werden die Tiere auf grausame Art und Weise umgebracht.
Grindwalfang ist auf den Färöer-Inseln schon lange Tradition Auf den Färoer-Inseln hat der Walfang eine jahrhundertelange Tradition. Die Wale ziehen mit ihren Kälbern aus den warmen Gewässern in Richtung Arktis, um zu fressen. Dabei kommen sie an der Inselgruppe im Nordatlantik vorbei. Werden die Wale im Wasser vor den Färöer-Inseln gesichtet, treibt die Dorfgemeinschaft sie in seichtere Gewässer, wo die Tiere getötet werden. Den gestrandeten Walen werden dazu die Venen und Arterien im Kopf mit Messern durchtrennt. Die Tiere, die nicht gestrandet sind, werden an die Küste gezogen - mit einem an einem Seil befestigten Haken, der ihnen durch ihr Blasloch gerammt wird. Dort durchtrennt man ihre Halsschlagader und lässt sie dann bei lebendigem Leib ausbluten. Dieser Todeskampf dauert teils mehrere Minuten.
Auf diese Weise werden jedes Jahr mehrere hundert Grindwale getötet, die meisten von ihnen im Juli und August. Alleine auf der kleinen Insel Vágar sind im vergangenen Monat über 180 Grindwale geschlachtet worden - die grausamen Bilder sehen Sie im Video. Tierschutzorganisationen wie "Sea Shepherd" kämpfen seit Jahren gegen dieses brutale Ritual. Doch das ist auf den Färöer-Inseln nicht nur legal, sondern eine fest verankerte Tradition, die schon vor Jahrhunderten dem Nahrungserwerb der Färinger diente, als die Versorgungslage auf den Inseln noch anders aussah.
Verzehr von Walfleisch ist bedenklich Das Fleisch der Grindwale wird nicht kommerziell gehandelt, sondern an alle Inselbewohner verteilt. Doch der Verzehr von Walfleisch ist nicht unbedenklich: 2008 riet die färöische Gesundheitsbehörde erstmals davon ab, Fleisch von Grindwalen zu verzehren, da dieses eine hohe Belastung mit Umweltgiften wie Quecksilber und Dioxinen aufweist. Seit 2011 gilt die Empfehlung, höchstens einmal im Monat Grindwalfleisch zu essen. In der EU ist das Abschlachten von Walen verboten. Die Färöer gehören zu Dänemark, verwalten sich aber autonom und sind kein Mitglied der Europäischen Union.
Massaker – Weißseitendelfine in Skálafjørður
Am 21. August 2017 wurde in der Nähe des färöischen Ortes Skálafjørður eine Schule von Weißseitendelfinen gesichtet, woraufhin der sogenannte „Mordalarm“ ausgerufen wurde. Die Tiere wurden mithilfe von Schnellbooten und Jet-Skis in den Strandbereich getrieben, wo sie einem blutigen Massaker zum Opfer fielen. 48 Weißseitendelfine wurden an diesem Tag brutal getötet, ein Ereignis, das erneut die grausamen Methoden der „Grindadrap“-Jagd auf den Färöer-Inseln verdeutlichte.
Eine blutige Bilanz der Treibjagdsaison 2017
Die Tragödie vom 21. August war Teil einer Serie von Treibjagden, die vom 21. Mai bis 22. August 2017 auf den Färöer-Inseln stattfanden. In dieser Zeit wurden insgesamt 1.302 Meeressäuger abgeschlachtet, darunter:
- 1.033 Grindwale
- 269 Weißseitendelfine
Diese 19 Treibjagden zeigen das Ausmaß, in dem Meeressäuger auf der Inselgruppe gejagt werden, und werfen erneut Fragen nach der Notwendigkeit und Grausamkeit dieser Praktiken auf.
Methoden und Kritik
Die Jagd erfolgt meist nach demselben Muster: Sobald eine Schule von Delfinen oder Walen gesichtet wird, wird ein „Mordalarm“ ausgelöst. Die Tiere werden mit lauten Motoren, Schnellbooten und Jet-Skis in Panik versetzt und in Buchten oder Strandbereiche getrieben. Dort werden sie brutal getötet, häufig mit Haken und Messern. Diese Methoden verursachen massives Tierleid und führen oft dazu, dass die Tiere minutenlang leiden, bevor sie sterben.
Die Grindadrap-Tradition im Fokus der Kritik
Die Grindadrap, die auf eine jahrhundertealte Tradition zurückgeht, wird von den Färingern als kulturelles Erbe verteidigt. Doch gerade die Jagd auf Weißseitendelfine hat in den letzten Jahren weltweit für Entsetzen gesorgt. Diese Tiere sind hochintelligent, sozial und zeigen starke Bindungen innerhalb ihrer Gruppen. Die Bilder und Drohnenaufnahmen der blutigen Strände haben die internationale Kritik an den Färöer-Inseln weiter angeheizt.
Ein Appell für Veränderung
Die Bilanz der Treibjagdsaison 2017 und die Ereignisse vom 21. August machen deutlich, dass ein Umdenken dringend notwendig ist. Traditionen, die auf der Grausamkeit gegenüber empfindungsfähigen Lebewesen basieren, haben in der heutigen Zeit keinen Platz mehr.
Tierschutzorganisationen und Umweltschützer fordern ein Ende der Grindadrap-Jagd und einen Schutzstatus für Meeressäuger wie Weißseitendelfine und Grindwale.
Die Weltgemeinschaft ist gefordert, Druck auf die färöische Regierung auszuüben, um diese grausamen Praktiken endgültig zu beenden. Meeressäuger spielen eine entscheidende Rolle in marinen Ökosystemen, und ihr Schutz ist ein entscheidender Schritt für den Erhalt der Ozeane und ihrer Bewohner.
Färöer-Inseln – Tradition oder Grausamkeit?
Die Färöer-Inseln, eine autonome Region im Nordatlantik, stehen seit Jahren wegen ihrer traditionellen Wal- und Delfinjagd, bekannt als „Grindadrap“, in der Kritik. Diese Praktik, bei der Hunderte von Walen und Delfinen in Buchten getrieben und brutal getötet werden, hat sich über Jahrhunderte hinweg etabliert. Doch während die Färinger sie als lebensnotwendigen Bestandteil ihrer Kultur verteidigen, sorgt sie weltweit für Entsetzen.
Ein umstrittenes Ritual
Die Jagd, die jedes Jahr im Sommer stattfindet, wird von den Behörden der Färöer-Inseln reguliert. Nach Angaben von 3sat wird ein „Grind“ erst freigegeben, wenn das Fleisch eines vorherigen vollständig aufgebraucht ist. Die Einwohner argumentieren, dass die Jagd überlebensnotwendig sei, da die karge Insel kaum landwirtschaftliche Ressourcen bietet. Das Fleisch der getöteten Tiere wird vollständig genutzt, um die Bevölkerung zu versorgen.
Doch die Bilder, die dabei entstehen, wirken auf Außenstehende grausam: Kinder, teils erst fünf Jahre alt, waten durch blutgetränktes Wasser. Walen werden Metallhaken in die Atemlöcher gerammt, bevor sie mit Messern getötet werden. Szenen wie diese schockieren Menschen weltweit und werfen die Frage auf, ob Tradition solche Praktiken rechtfertigen kann.
Einblicke eines Beobachters
Alastair Ward, ein 22-jähriger Student, der die Jagd beobachtet hat, beschrieb die Szenen in der „Daily Mail“ als hemmungslos brutal. „Erst werden den Walen Haken in die Atemlöcher gerammt, dann wird mit Messern auf ihnen herumgehackt.“ Diese Berichte verstärken die internationale Kritik an der Waljagd.
Kinder und die Normalisierung der Gewalt
Besonders schockierend ist die Teilnahme von Kindern an den Grindadrap-Treibjagden. Bereits im jungen Alter werden sie mit der Gewalt konfrontiert und eingebunden, was zu einer Normalisierung der brutalen Szenen führen könnte. Kritiker warnen, dass dies nicht nur ethische Fragen aufwirft, sondern auch langfristige Auswirkungen auf die psychologische Entwicklung der Kinder haben könnte.
Die Rolle von Tierschutzorganisationen
Tierschutzgruppen wie Sea Shepherd kritisieren die Grindadrap-Jagd seit Jahren scharf. Sie argumentieren, dass die Praxis nicht mehr zeitgemäß sei und gegen EU-Gesetze verstoße. Zwar gehören die Färöer-Inseln zum dänischen Königreich, doch ihre weitgehende Autonomie bedeutet, dass EU-Auflagen auf den Inseln nicht gelten.
Eine Tradition auf dem Prüfstand
Die Färinger verteidigen die Grindadrap als notwendigen Bestandteil ihrer Kultur und ihres Überlebens. Doch angesichts moderner Importmöglichkeiten und wachsender globaler Kritik stellt sich die Frage, ob Traditionen wie diese noch einen Platz in der heutigen Zeit haben.
Die Welt fordert zunehmend, dass das Leid und der Tod empfindungsfähiger Lebewesen nicht mit kulturellen Argumenten gerechtfertigt werden sollten. Traditionen, die auf Grausamkeit basieren, müssen hinterfragt und durch nachhaltige Alternativen ersetzt werden. Die Färöer-Inseln stehen vor der Herausforderung, den schmalen Grat zwischen Tradition und Modernität zu finden.
Walfang auf den Färöer-Inseln
Seit Jahrhunderten prägt der Grindwalfang, bekannt als Grindadrap, die Kultur und Geschichte der Färöer-Inseln. Doch während viele Einwohner diese Praktik als essenziellen Bestandteil ihres Lebens betrachten, wächst der internationale Druck, die blutige Tradition zu beenden.
Tierschutzorganisationen kritisieren die Jagd als grausam und unnötig, und die Forderungen nach einem Boykott der Inseln als Urlaubsziel nehmen zu.
Die Perspektive der Einwohner
Für die Bewohner der Färöer-Inseln ist der Grindwalfang mehr als eine Tradition – er gilt als wichtige Nahrungsquelle. Auf der kargen Inselgruppe wachsen nur wenige Pflanzen, und die Fleisch- und Fettvorräte der Grindwale spielen eine bedeutende Rolle in der Ernährung der Bevölkerung. Die Jagd wird strikt reguliert, und das Fleisch wird unter den Teilnehmern aufgeteilt, ohne kommerziellen Gewinn.
Viele Färinger verteidigen die Praxis als nachhaltig, da das gesamte Tier verwertet wird und es sich um eine jahrhundertealte Methode handelt, die ihre kulturelle Identität bewahrt. Doch selbst auf den Inseln wird die Notwendigkeit des Grindadrap zunehmend hinterfragt, insbesondere in Anbetracht moderner Alternativen.
Kritik der Tierschutzorganisationen
Tierschutzgruppen wie Sea Shepherd und andere Aktivisten kritisieren die Jagd als archaisch und grausam. Grindwale, Delfine und andere Meeressäuger sind hochintelligente und soziale Lebewesen. Die Jagdmethoden – das Treiben der Tiere in enge Buchten und das anschließende Töten mit Messern und Speeren – verursachen massiven Stress und großes Tierleid.
Internationale Proteste fordern, dass die Tradition aufgegeben wird. Der Druck wächst auch durch die Forderung, die Färöer-Inseln als Urlaubsziel zu meiden. Dies ist ein empfindlicher Punkt, denn neben der Fischerei ist der Tourismus eine der Haupteinnahmequellen der Inselgruppe.
Tradition auf dem Prüfstand
Die Dokumentation „Re:“ begleitet sowohl die Bewohner der Färöer-Inseln, die ihre Tradition verteidigen, als auch die Tierschützer, die für ein Ende der Grindadrap-Jagd kämpfen. Dabei wird die zentrale Frage aufgeworfen: Ist der Grindwalfang noch zeitgemäß?
Während die Färinger ihre Kultur und Eigenständigkeit betonen, wird zunehmend deutlich, dass diese Tradition in der heutigen Zeit immer schwieriger zu rechtfertigen ist. Mit wachsendem Umweltbewusstsein und ethischen Ansprüchen hinterfragt die globale Gemeinschaft, ob der Erhalt einer Tradition das Leid von Meeressäugern rechtfertigen kann.
Ein Wendepunkt?
Die Debatte um den Grindwalfang auf den Färöer-Inseln zeigt die Spannungen zwischen kulturellem Erbe und modernen ethischen Standards. Die Bewohner der Inseln stehen vor der Herausforderung, ihre Identität zu bewahren, während sie sich dem zunehmenden internationalen Druck anpassen müssen.
Ob der Walfang auf den Färöer-Inseln endgültig beendet wird, hängt nicht nur von lokalen Entscheidungen ab, sondern auch vom Einfluss internationaler Proteste und der Bereitschaft, neue Wege zu finden, die Tradition mit Mitgefühl und Nachhaltigkeit zu verbinden.
TUI Cruises und die Anlandungen auf den Färöer-Inseln
Der Kreuzfahrtanbieter TUI Cruises steht seit Jahren in der Kritik, seine Anlandungen auf den Färöer-Inseln fortzusetzen, obwohl die Inselgruppe regelmäßig durch die blutigen Grindwalfänge, das sogenannte Grindadrap, weltweit für Entsetzen sorgt.
Versprechen ohne Taten?
Bereits im Jahr 2015 hatte das Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF) nach einem Boykottaufruf gegenüber TUI Cruises die Zusicherung erhalten, dass das Unternehmen seine Anlandungen auf den Färöer-Inseln überprüfen würde. Trotz dieser Ankündigung laufen die Schiffe der „Mein Schiff“-Flotte die Häfen der Inseln weiterhin regelmäßig an – unbeirrt von den jährlich stattfindenden Walmassakern.
Die Kritik wurde 2017 erneut lauter, nachdem allein zwischen Mai und Juli fast 1.000 Meeressäuger, darunter Grindwale und Weißseitendelfine, brutal abgeschlachtet wurden. Im Gegensatz zu anderen deutschen Kreuzfahrtunternehmen, die ihre Anlandungen auf den Färöer-Inseln gestoppt haben, zeigt sich TUI Cruises unbeeindruckt von den Protesten.
Ein unverantwortliches Risiko
Ein besonders kritischer Punkt ist, dass die Anlandungen von TUI-Schiffen Gäste und deren Kinder potenziell zu Augenzeugen der grausamen Jagdszenen machen könnten. So liegt beispielsweise der Hafen von Tórshavn – eine Anlaufstelle für „Mein Schiff 4“ – nur wenige Kilometer von einer der Schlachtbuchten entfernt. Bei den blutigen Walfangaktionen färbt sich das Meerwasser rot, und die Schreie der Tiere sind weithin hörbar. Ein solches Erlebnis könnte bei den Touristen, insbesondere bei Kindern, schwerwiegende Traumata auslösen.
Boykottaufruf bleibt bestehen
Das WDSF kritisiert das Verhalten von TUI Cruises scharf und hält den Boykottaufruf weiterhin aufrecht. Es fordert das Unternehmen auf, sich wie andere Kreuzfahrtanbieter ethisch verantwortlich zu zeigen und die Färöer-Inseln als Reiseziel aus dem Programm zu nehmen.
Ein Appell an das Bewusstsein
Die fortgesetzte Anlandung von TUI Cruises wirft die Frage auf, ob wirtschaftliche Interessen über ethische und moralische Grundsätze gestellt werden dürfen. Für viele Umwelt- und Tierschützer ist klar: Solange das Grindadrap auf den Färöer-Inseln praktiziert wird, sollten touristische Besuche – insbesondere durch große Kreuzfahrtunternehmen – vermieden werden, um den Druck auf die Verantwortlichen zu erhöhen und ein klares Zeichen gegen Tierquälerei zu setzen.
Die Debatte zeigt erneut, wie wichtig es ist, Verantwortung für die Orte zu übernehmen, die man bereist, und die Konsequenzen des eigenen Handelns zu bedenken – für den Schutz der Natur, der Tiere und zukünftiger Generationen.
Boykottaufruf gegen die färöische Band Týr aufgrund des Walfangs
Die Viking-Metal-Band Týr von den Färöer-Inseln steht seit Jahren im Kreuzfeuer der Kritik. Der Grund: Frontmann Heri Joensen hat sich öffentlich zur Teilnahme an der traditionellen Waljagd auf den Inseln, dem sogenannten Grindadrap, bekannt. Infolgedessen rief das Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF) zu einem Boykott der Band auf, insbesondere in Deutschland.
arte „Tracks“ beleuchtet den Konflikt
Der Kultursender arte widmete sich in der Sendung „Tracks“ diesem kontroversen Thema und führte Interviews mit beiden Seiten:
- Jürgen Ortmüller, Geschäftsführer des WDSF, äußerte sich scharf gegen die Band und insbesondere gegen Joensens aktive Beteiligung an den blutigen Waljagden. Ortmüller betonte, dass es unvereinbar sei, künstlerische Auftritte zu fördern, wenn die Künstler gleichzeitig an einer als grausam angesehenen Tradition teilnehmen.
- Heri Joensen, der Sänger und Gitarrist von Týr, verteidigte seine Teilnahme am Grindadrap. Er argumentierte, dass die Jagd Teil der kulturellen Identität der Färöer sei und nachhaltig durchgeführt werde. Joensen sieht in der Kritik eine Missachtung der färöischen Kultur durch Außenstehende.
Der Boykott in Deutschland
Der Boykottaufruf des WDSF hat in Deutschland zu erheblichen Konsequenzen für die Band geführt. Zahlreiche Konzerte wurden abgesagt oder verschoben, und Veranstalter distanzierten sich öffentlich von Týr. Insbesondere in der Metal-Szene, die häufig für ihre Offenheit und ihre Unterstützung traditioneller Themen bekannt ist, sorgt der Fall für eine hitzige Debatte.
Kultur versus Tierschutz
Das Beispiel Týr zeigt die Spannungen zwischen kulturellem Erbe und modernen ethischen Standards. Während die Färöer-Inseln ihre Walfangtradition als nachhaltige Praxis verteidigen, sehen Kritiker darin ein archaisches und grausames Ritual, das keinen Platz in der heutigen Welt hat.
„Tracks“ bietet eine differenzierte Perspektive
Die arte-Sendung „Tracks“ ermöglicht es, beide Seiten der Debatte zu verstehen, und beleuchtet, wie der Boykott nicht nur die Band Týr, sondern auch die Wahrnehmung der färöischen Kultur beeinflusst. Der Konflikt zwischen den Forderungen nach Tierschutz und dem Erhalt kultureller Traditionen bleibt jedoch bestehen – und scheint in Zeiten wachsender Umwelt- und Tierschutzbewegungen weiter an Brisanz zu gewinnen.
Die zentrale Frage
Die Debatte wirft eine grundlegende Frage auf: Wie weit darf kulturelle Identität gehen, wenn sie mit modernen ethischen Standards kollidiert? Für Týr und ihre Unterstützer ist der Walfang Teil ihres Erbes. Für Tierschützer wie das WDSF bleibt er jedoch ein Symbol für unnötige Tierquälerei.
Kinderbeteiligung am Walfang: Erschreckende Szenen auf den Färöer-Inseln
Am 20. August 2017 wurden im färöischen Ort Borðoyarvík 27 Grindwale während einer Treibjagd brutal getötet. Besonders schockierend ist die Beteiligung von Kindern an diesem blutigen Ritual, wie Fotos und Videos des färöischen Mediums "Norðlýsið" dokumentieren.
Kinder mitten im Geschehen
Die Aufnahmen zeigen Kinder, die während des öffentlichen Walfangs aktiv im blutgetränkten Wasser agieren. Einige von ihnen hantieren mit den Körpern der toten Tiere, während Erwachsene sie bei der Jagd begleiten. Laut Beobachtern waren einige der Kinder nicht älter als fünf Jahre. Dieses Ritual, das auf den Färöer-Inseln tief in der Kultur verwurzelt ist, wird von vielen Tierschützern als nicht nur grausam, sondern auch pädagogisch unverantwortlich kritisiert.
Strafanzeige durch das WDSF
Das Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF) hat auf diese Vorfälle reagiert und Strafanzeige bei den Justizbehörden der Färöer-Inseln und Dänemarks gestellt. Nach Ansicht des WDSF verstößt die Teilnahme von Kindern an solch brutalen Praktiken gegen grundlegende ethische und moralische Standards sowie möglicherweise gegen rechtliche Bestimmungen.
TUI Cruises in der Kritik
Die Rolle von Kreuzfahrtunternehmen wie TUI Cruises wird in diesem Zusammenhang erneut kritisch beleuchtet. TUI Cruises bietet mit der "Mein Schiff"-Flotte regelmäßig Landausflüge auf den Färöer-Inseln an, wo Touristen und ihre Kinder potenziell Zeugen der blutigen Walfänge werden könnten. Die Tierschutzorganisation WDSF wirft dem Unternehmen vor, solche Grausamkeiten indirekt zu unterstützen, indem es weiterhin die Färöer-Inseln als Reiseziel bewirbt.
Eine gefährliche Normalisierung
Die Beteiligung von Kindern an diesen Treibjagden könnte langfristige psychologische Auswirkungen haben, warnen Experten. Die Normalisierung von Gewalt gegen Tiere in jungen Jahren sei problematisch und könne die emotionale Entwicklung der Kinder negativ beeinflussen.
Ein Aufruf zum Handeln
Der Vorfall in Borðoyarvík verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, sowohl die Praxis des Walfangs als auch die Einbindung von Kindern in diese Aktivitäten kritisch zu hinterfragen. Tierschutzorganisationen fordern nicht nur ein Ende der Waljagd, sondern auch strengere internationale Maßnahmen, um Kinder vor der Teilnahme an solchen blutigen Traditionen zu schützen.
Das Bild der Färöer-Inseln
Während die Färöer-Inseln ihre Walfangtradition verteidigen, gerät das Image der Inselgruppe zunehmend in den Fokus internationaler Kritik. Vorfälle wie dieser verstärken den Druck auf die Verantwortlichen, diese Praktiken zu überdenken und endlich zu handeln.
Die blutige Tradition des Walfangs auf den Färöer-Inseln
Die Färöer-Inseln, eine autonome Inselgruppe im Nordatlantik, sind weltweit für ihre umstrittene Walfangtradition bekannt. Jedes Jahr werden dort Tausende Grindwale, Schnabelwale und Delfine im Rahmen des sogenannten Grindadráp getötet.
Brutale Jagdmethode
Die Meeressäuger werden mit modernen Motorbooten in Buchten getrieben. An den Stränden werden ihnen mit Metallhaken tiefe Wunden zugefügt, indem die Haken in ihre Blaslöcher gerammt werden. Anschließend wird ihnen das Rückgrat durchtrennt, was die Tiere langsam und qualvoll sterben lässt. Oft schwimmen noch lebende Familienmitglieder stundenlang im Blut ihrer Angehörigen, in Panik und Angst vor dem eigenen Schicksal.
Konflikt mit dänischen und EU-Gesetzen
Obwohl die Färöer-Inseln Teil des dänischen Königreichs sind, besitzen sie autonome Gesetze, die es ihnen erlauben, diese Jagden durchzuführen. Dänemark selbst hat den kommerziellen Walfang eingestellt und ist an das Walfang-Moratorium der Internationalen Walfangkommission (IWC) gebunden. Allerdings gelten diese internationalen Abkommen und auch EU-Gesetze auf den Färöer-Inseln nicht.
Internationale Kritik und Forderungen
Tierschutzorganisationen weltweit kritisieren diese Praxis als grausam und nicht mehr zeitgemäß. Sie fordern ein Ende der Waljagden und appellieren an Dänemark, seine politische Verantwortung wahrzunehmen. Besonders problematisch ist, dass die Jagd nicht nur aus traditionellen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen verteidigt wird – das Fleisch der getöteten Tiere wird verteilt und konsumiert, obwohl es durch den hohen Quecksilbergehalt gesundheitsschädlich sein kann.
Ein Ruf nach Veränderung
Die blutigen Bilder des Grindadráp und der anhaltende Protest von Umwelt- und Tierschutzorganisationen werfen eine zentrale Frage auf: Ist es im 21. Jahrhundert noch vertretbar, solche Traditionen zu bewahren, wenn sie mit ethischen und moralischen Grundsätzen kollidieren?
Die Färöer-Inseln stehen zunehmend unter Druck, ihre Praktiken zu überdenken – nicht nur aus moralischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen, da der Tourismus eine wachsende Bedeutung für die Inselgruppe hat und durch internationale Boykottaufrufe gefährdet wird.